|
Die Neuen Kammern Einführung |
mutatas dicere formas Wie klangen Ovids Metamorphosen? |
|
Marita Müller
Die Neuen Kammern: Einführung
Ein außergewöhnliches Beispiel der
künstlerischen Rezeption von Werken Ovids sind die Metamorphosen-Reliefs
in der Ovid-Galerie
in den Neuen Kammern. Die Neuen Kammern sind das kleine Fest- und Gästeschloss von
Friedrich II. (regierte 1740-1786) im Park von Potsdam-Sanssouci. Sie
entstanden 1771-1774/5 durch den von Georg Christian
Unger (1743-1799) geleiteten Umbau des 1747
durch Georg Wenzeslaus von
Knobelsdorff (1699-1753) errichteten Orangeriehauses
südwestlich des Schlosses Sanssouci.

Die Neuen Kammern (Ansicht von Süden; dahinter: Historische Mühle)
(Foto © Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg)
Die
Ovid-Galerie, eine der berühmtesten Galerien des friderizianischen Rokoko,
gehört neben der Blauen Galerie, dem Buffet-Saal und dem Jaspis-Saal
zu den
Festsälen, die 1773-1774 ausgestaltet wurden. Ebenso wie die Konzertsäle
in den Schlössern Rheinsberg, Sanssouci oder dem Neuen Palais (im Park
Sanssouci) wurde die
Ovid-Galerie mit Darstellungen aus den Metamorphosen des römischen Dichters
Ovid (43 v.Chr.
– ca. 17 n.Chr.) geschmückt. Sie waren eine der Lieblingslektüren des preußischen
Königs.
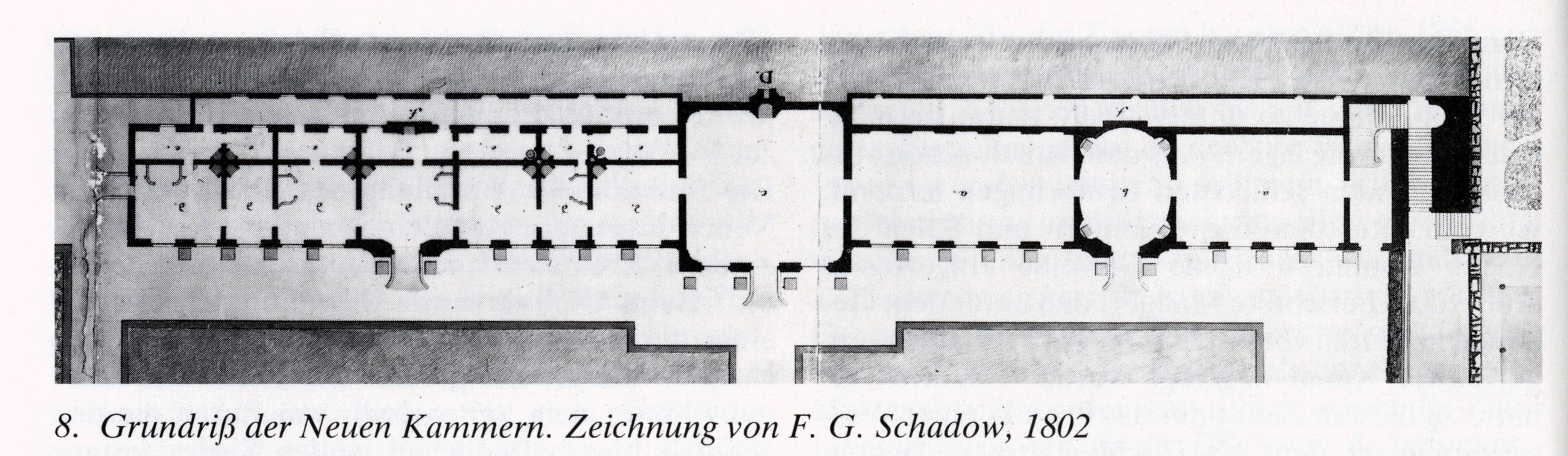
Grundriss der Neuen Kammern
(Quelle: Die Neuen Kammern im Park Sanssouci, hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci, Potsdam-Sanssouci 1987, S. 16)
Die vergoldeten, fast lebensgroßen Stuckreliefs der Ovid-Galerie wurden
nach dem Entwurf von Johann Christian
Hoppenhaupt (1719-1778/86)
von den Bayreuther Bildhauer-Brüdern Johann David
Räntz (1729-1783) und Johann
Lorenz Wilhelm Räntz (1733-1776) ausgeführt. Sie zeigen an der südlichen
Gartenseite, an der nördlichen Spiegelwand und an den Schmalseiten
vierzehn unterschiedliche Geschichten. Die Liebesgeschichten Jupiters und
Apolls beherrschen in freizügiger Darstellung die Galerie. In figürlicher
oder thematischer Symmetrie dazu stehen die erotischen Abenteuer von
Neptun, Bacchus und Venus, zu denen Szenen wie die „Befreiung
Andromedas“ und die „Verführung Pomonas“ kommen, bei denen das erzählende
Moment überwiegt.
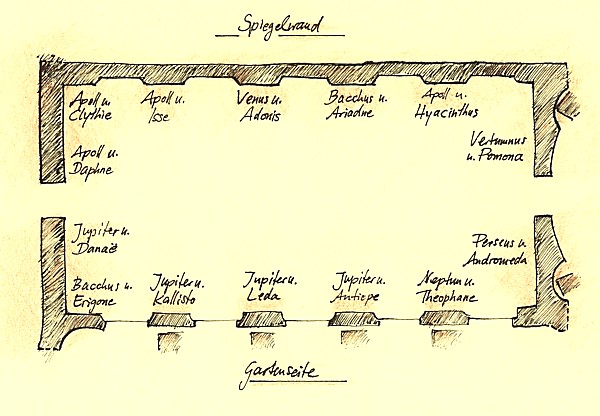
Ovid-Galerie: Grundriss mit Metamorphosen-Motiven
(Zeichnung © Nina Mindt / Mutatas dicere formas: Ovid-Projekt Berlin/Potsdam)
Die Metamorphosen werden in jeweils unterschiedlichen Phasen gezeigt. So
verwandeln sich auf den Reliefs der Spiegelwand zumeist die Geliebten der
Göttinnen und Götter in eine florale oder astrale Gestalt. Eifersucht,
Zurückweisung, aber auch die glückliche Liebe der Götter mit Sterblichen
sind Motive dieser Metamorphosen, so bei Apoll und Clytie, Apoll und
Hyazinth, Bacchus und Ariadne, die zum Weiterleben der Geliebten in
einer verwandelten, meist floralen Gestalt führen. Auf der Gartenseite
sind es hingegen die Götter, die sich – zumeist in Tiere – verwandeln.
Diese Metamorphosen sind Mittel zur Verführung und verhelfen dem
erotischen Verlangen der Götter zur Befriedigung.

Ovid-Galerie (Blick nach Osten)
(Foto © Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg)
Die Metamorphosen-Reliefs der Ovid-Galerie reihen sich somit in ihrer
thematischen Auswahl in den für die künstlerische Ausgestaltung einer
herrschaftlichen Sommerresidenz des 18. Jahrhunderts typischen idyllischen und
bukolischen Themenkreis mit göttlichen Liebesgeschichten ein. Diese Thematik
des höfischen Arkadien dominierte die Konzertsäle
Friedrichs des Großen.
Aufgrund ihrer formalen und stilistischen Gestaltung stellen die Reliefs
zugleich den Höhepunkt der Ovid-Rezeption unter
Friedrich II. und im
Kontext ihrer Aussagekraft das wohl repräsentativste Beispiel der unter
diesem Monarchen noch präsenten absolutistischen Apoll- und Jupiterikonographie dar.
Copyright © 2004, Mutatas dicere formas: Ovid-Projekt Berlin/Potsdam
Zuletzt aktualisiert: 12.11.2004
